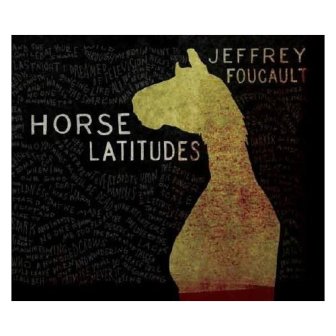Die 1983 in Graz geborene Autorin und Regisseurin Astrid Kohlmeier hat mit ihren Stück „Black Dogs“ die Grenze zwischen Kunst und Leben überschritten. In gemeinsamer Arbeit mit Depressiven wurde ein Theaterabend konzipiert, der die tabuisierte Krankheit Depression sowohl dokumentarisch als auch mit den fiktionalen Mitteln des Theaters erfahrbar machen will. Plattform sprach mit ihr über „Black Dogs“, die Arbeit am Stück, sowie die Resonanz des Publikums.
Die 1983 in Graz geborene Autorin und Regisseurin Astrid Kohlmeier hat mit ihren Stück „Black Dogs“ die Grenze zwischen Kunst und Leben überschritten. In gemeinsamer Arbeit mit Depressiven wurde ein Theaterabend konzipiert, der die tabuisierte Krankheit Depression sowohl dokumentarisch als auch mit den fiktionalen Mitteln des Theaters erfahrbar machen will. Plattform sprach mit ihr über „Black Dogs“, die Arbeit am Stück, sowie die Resonanz des Publikums.
Plattform: Mich würde interessieren, wie du auf die Idee gekommen bist, ein Stück über Depressivität zu machen und dann eben nicht zu sagen, ich nehme mir Schauspieler, die sich halt in die Rolle des Depressiven hineinversetzen und den dann spielen, sondern eben Depressive zu nehmen?
Astrid Kohlmeier: Also, erstens muss ich sagen, dass das leider keine Idee von mir ist. Das heißt, es war eine Idee vom Intendanten des Landestheaters Schwaben in Memmingen und des Herrn Walter Weyers. Walter Weyers hat vor einigen Jahren eine Reihe erfunden, die heißt „Ausgegrenzt“, und in dieser Reihe arbeitet er einfach mit – wie man das heute nennt – Experten des Alltags. Das heißt, da gab es Projekte mit arbeitslosen Jugendlichen, mit Strafgefangenen, mit psychisch Kranken und „Black Dogs“ war ein Projekt aus dieser Reihe, die Walter Weyers ins Leben gerufen hat und Walter Weyers hat mich dann darauf angesprochen, ob ich nicht die Regie übernehmen möchte.
Plattform: Die Resonanz auf dein Stück war eigentlich, hattest du erzählt, sehr gut. Dann gab es auch Kritiker, wie einen Herrn vom Bayrischen Rundfunk, der damit nicht ganz klargekommen ist. Die Resonanz, wenn du das noch mal auch kurz im Rückblick jetzt betrachtest, hat die dich überrascht, oder hast du eigentlich damit gerechnet?
Astrid Kohlmeier: Also, ich habe eigentlich damit gerechnet, dass das Stück eine große Resonanz haben wird, weil es ja hier bei Depressionen um ein Thema geht, das sehr tabuisiert ist nach wie vor und das Schöne an diesem Projekt war, dass das Theater eine Plattform geboten hat und einfach sehr viele Menschen, also ob es jetzt Betroffene sind, Angehörige, Menschen, die professionell damit zu tun haben, also Ärzte und Psychotherapeuten usw., dass diese Menschen einfach ein großes Bedürfnis haben sich damit auseinanderzusetzen und das ist ja eine Krankheit, die sich im Verborgenen abspielt. Das heißt dann, die Menschen trauen sich nicht darüber zu sprechen, es ist ganz viel Scham im Spiel. Die Patienten schämen sich dafür diese Krankheit zu haben und dann wird das sehr oft auch verheimlicht oder vertuscht und deshalb ist es so, dass das Stück sehr gut angenommen worden ist, weil es einfach ein offenerer Umgang damit ist und eine Plattform bietet, einen Diskurs anregt. Ich war sehr erstaunt, dass die Resonanz so groß war. Also, ich dachte, dass da viele Menschen kommen werden, aber es war dann so: es gab siebzehn Vorstellungen, die waren alle ausverkauft und zwar mehr als ausverkauft. Da kamen Leute von weiter angereist und es hat einfach einen Diskurs angeregt; das heißt, es gab jedes Mal nach dem Stück eine Diskussion und es ist dann schon erstaunlich, wenn dann noch mal so vierzig Leute dableiben und noch Mal zwei Stunden miteinander sprechen, diskutieren, wo man auch merkt, dass ein großes Bedürfnis nach Kommunikation besteht und dass Theater dieses Bedürfnis anregen kann und dieses Bedürfnis erfüllen kann. Das war sehr schön zu sehen, dass man ein Problem loswird. Und man spricht ja oft davon, dass Theater keine Zukunft hat und vom „Tod des Theaters“. Das war genau das Gegenteil. Man hat gesehen, wenn man Theater mit Leben verbindet und so museales Theater macht, dass da sehr wohl ein Publikum kommt und dass es wunderbar angekommen wird und dass Theater gesellschaftlich relevant sein kann und muss. Und nun waren wir mit dem Stück auch bei den Theatertagen in Regensburg, haben auf einer kleinen Bühne gespielt. Da waren ungefähr hundertzwanzig Besucher und interessant war, dass danach eine Diskussion angesetzt war, aber nicht mit den Darstellern, wie wir das in Memmingen gemacht hatten, sondern es gab den ausdrücklichen Wunsch dieses Moderators, der auch in der Jury der Theatertage saß, mit mir zu sprechen. Und in diesem Gespräch wurde dann sehr schnell klar, dass kritisiert wurde, dass man solche Menschen mit solchen Mängeln, dass man die auf die Bühne stellt. Es gab den Vorwurf des Ausstellens. Da hat man einfach gemerkt, dass viele Menschen noch ein Problem damit haben, wenn sie Menschen auf der Bühne sehen; also nicht Schauspieler, die wunderbar sprechen und wahrscheinlich auch noch gut aussehen und Kunst machen, sondern wenn sie normale Menschen auf der Bühne sehen, die vielleicht auch noch ein Problem haben, das sie mit vielen anderen teilen. Und das macht scheinbar angst und das wurde auch kritisiert. Es gab da die Frage, ob es eine Art von Casting gegeben hätte. Also ob man vielleicht nicht andere Depressive hätte aussuchen können für diese Veranstaltung, was natürlich gegen dieses ganze Konzept spricht. Weil man kann nicht den depressivsten Depressiven casten; wir sind nicht bei „Deutschland sucht den Superstar“.
Dieses Unverständnis hat mich dann auch sehr irritiert; die Frage nach der Suche nach dem bühnenwirksamsten – oder vielleicht attraktivsten – Depressiven. Das fand ich schon sehr erschreckend und unmenschlich und da war ich doch sehr erstaunt, wie man auf so eine Idee kommen kann überhaupt. Das Schöne daran war, dass das Publikum sich dann gewehrt hat. Also Publikum ist ja auch oft etwas schüchtern und für mich war es sehr schön zu sehen, dass sich ungefähr hundert Menschen gegen einen Theaterkritiker erheben. Das gibt es ja selten, weil normalerweise sind es die Theaterkritiker, die in den Zeitungen schreiben und dann auch zur Meinungsbildung beitragen und da war es dann umgekehrt. Da hat sich dann so ein Prozess in Gang gesetzt, dass dann plötzlich das Publikum sozusagen den Theaterkritiker vom Podest verjagt hat und die Darsteller auf die Bühne gebeten hat. Das war sehr schön zu sehen, dass das Publikum sich so mündig verhält und da auch eingreift in so einen Prozess.
Plattform: Gab es Berührungsängste von Seiten der Darsteller, oder war es von Anfang an ein offener Prozess und Bedürfnis, dass die sich dann sehr mit einbringen?
Astrid Kohlmeier: Also es war sehr unterschiedlich. Es gab natürlich Berührungsängste. Das Grundproblem war mal dies: Wir hatten mehrere Beteiligte angemeldet; zur Konzeptionsprobe erschien dann eigentlich nur eine Darstellerin (lacht) und ein Darsteller, der mir aber von vornherein gesagt hatte, dass er im Hintergrund seine Geschichte gerne einbringt, aber selber nicht auf der Bühne stehen möchte. Das heißt, wir standen beim Probenbeginn mit einer Darstellerin da und einem Darsteller, der nicht auf die Bühne wollte, verständlicherweise, weil gerade Depression ist ja eine Krankheit, wo man sich zurückzieht. Und eigentlich ist das schon ja an sich absurd – der Gedanke ein Stück mit Depressiven zu machen, weil natürlich in einer akuten Phase der Depressive alles andere möchte als sich vor Publikum hinzustellen. Man hat in dieser Phase ja Angst vor Menschen und vor Kontakt und möchte sich am liebsten verstecken.
Und dann war das eben so, dass vom Intendanten wurde mir angeboten, dass ich noch einen anderen Schauspieler dazuhaben könnte. Ich wollte den nicht. Ich wollte ja den Depressiven sozusagen eine Stimme verleihen. Und dann war mein Gedanke einfach der: wenn die Depressiven nicht ins Theater kommen, dann kommt das Theater zu den Depressiven. Das heißt konkret: wir haben das ganze Konzept umgeworfen, haben auf dokumentarische Formen umgeschaltet und sind dann mit Kamera und mit Aufnahmegerät in den sozial-psychatischen Dienst und hatten natürlich so ein Annährungsprozess. Das geht nicht von dem einen Tag auf den anderen, wenn man da reingeht. Sondern man war angemeldet, dann gab es einmal in der Woche so ein Kaffeetrinken. Und natürlich haben da sehr viele Leute gefehlt, weil die das auch nicht so gerne haben, wenn da jemand von außen reinkommt. Und dann habe ich da drin im sozialpsychatischen Zentrum das Projekt vorgestellt, habe angeboten, dass die Leute mitmachen können und zwar insofern, dass sie etwas beitragen können und zwar so wie sie es gerne möchten. Das heißt, niemand muss da auf die Bühne, sondern ich habe angeboten, wir können Interviews machen, sie können Texte schreiben, sie können Gedichte einlesen, sie können einfach das, was sie gerne sagen möchten oder mitteilen möchten, in der Art und Weise machen, wie es für sie möglich ist. Und dann haben wir meine Telefonnummer auf den Tisch gelegt und dann kamen ganz schüchtern so nach und nach so Anrufe, wo die diversen Menschen angerufen haben und haben gesagt: „Ich möchte gerne mitmachen.“, „Ich möchte etwas einlesen“, „Ich möchte mit Ihnen sprechen; wir können ein Interview machen“, „Ich habe einen Text verfasst, vielleicht können sie den gebrauchen.“ Und dann sind wir eigentlich jeden Tag ins sozialpsychatische Zentrum und haben uns dann mit den Menschen getroffen, die da sich gemeldet haben. Das war ein sehr sehr intimer Prozess; es war auch so wunderbar. Es war Sprache finden – gemeinsame Sprache finden. Also dieses ganze Projekt hat so eine Kommunikationsstruktur hervorgerufen. Also es war von Anfang an so, dass ich allen Beteiligten gesagt habe, sie können mir immer sagen, wenn sie erschöpft sind, wenn sie etwas nicht machen wollen, wenn es ihnen nicht gut geht und dass wir dann sofort abbrechen. Das heißt, es war eine sehr offene Kommunikation, wo auch respektiert wird, dass jemand nicht mehr kann, nicht mehr möchte, müde ist, traurig ist, nicht reden kann, nicht auf die Bühne gehen kann…
Plattform: Und das hat dann auch dazu geführt, dass die Schauspieler – nicht Schauspieler, sondern die Betroffenen – das gerne weiterführen wollen.
Astrid Kohlmeier: Genau. Also die Beteiligten, die haben erst einmal eine wunderbare Liebe zum Theater entwickelt, zu diesem Arbeitsprozess, also da eingebunden zu sein und zu merken, dass man gebraucht wird. Und auch, dass man etwas mitteilen kann. Da ist dieser wunderbare Satz gefallen. Also ein Herr hat gesagt, er macht da mit, weil die Krankheit dann vielleicht doch einen Sinn macht. Also dieses ganze Leid umzuwandeln in etwas Gutes, das war für die Beteiligten ein großes Glück einfach – ein Glücksgefühl ausgelöst. Also einerseits, dass sie sich verstanden gefühlt haben und andererseits, dass sie helfen können, damit, dass sie sprechen oder spielen.
Plattform: Vielen Dank! Ich wünsche dir für deine Projekte und für die nächste Zeit frohes Gelingen und alles Gute. Ich bedanke mich recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, hier zu ins Studio zu kommen.
Astrid Kohlmeier: Es war mir eine große Freude.