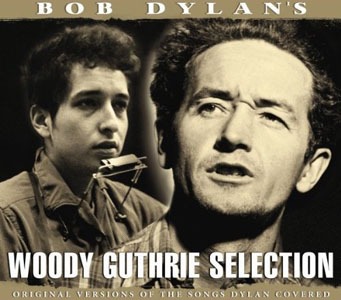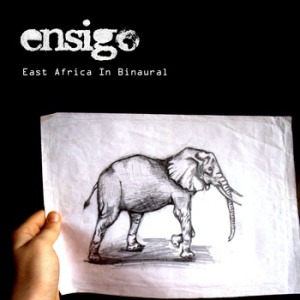Mit seinem neuen Album „Seventh Hour“ geht der kanadische Bluesgitarrist ein ganzes Stück „back to the roots“. War der Vorgänger „Midnight Memphis Sun“ irgendwo zwischen Soul und klassischem Rhythm & Blues angesiedelt, so konzentriert er sich jetzt auf einen zeitlosen Gitarrenblues irgendwo zwischen Albert Collins und Jimmy Vaughan.
Mit seinem neuen Album „Seventh Hour“ geht der kanadische Bluesgitarrist ein ganzes Stück „back to the roots“. War der Vorgänger „Midnight Memphis Sun“ irgendwo zwischen Soul und klassischem Rhythm & Blues angesiedelt, so konzentriert er sich jetzt auf einen zeitlosen Gitarrenblues irgendwo zwischen Albert Collins und Jimmy Vaughan.
Dieses Album ist für mich wirklich überraschend. Nachdem ich JW-Jones erstmals mit „Midnight Memphis Sun“ kennengelern hatte, sortierte ich ihn für mich erstmal in der Nachbarschaft von Musikern wie James Hunter ein. Doch das ist so mit „Senventh Hour“ nicht mehr durchzuhalten. Klar: die elegante Gitarre von Jones ist noch immer fernab von jedem übermäßigen „Dreck“ im Klang.
Doch ist das ohne eine große Gästeschar und im wesentlichen mit seiner Tourband eingespielte Album wesentlich druckvoller und dringlicher gespielt. Stilistisch ist das keine Revolution – wenn man denn nicht die eigentliche Revolution darin sieht, sich konsequent am Klangideal der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts zu orientieren. Das bedeutet auch, zeitgenössische Rockismen zu vermeiden. Der „Rock“ der Musik ist eher eine Relexion des klassischen Rock&Roll als ein Fortschreiben etwa der Traditionen von Jimi Hendrix. Und die Balladen wie „What Is Real“ zeigen, dass Jones als Sänger in der Nachbarschaft von Roy Orbison oder Little Milton bestehen kann. Das ist elektrischer Blues von einer wirklich zeitlosen Qualität, ein Album für Genießer, die auch die unaufgeregten Gitarrenstile von Jimmy Reiter, Dr. T. oder Philipp Fankhauser zu schätzen wissen.