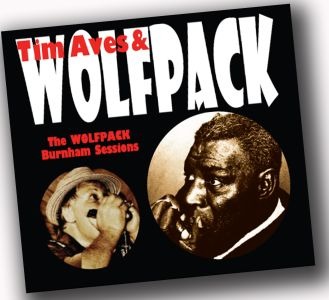VORABDRUCK FREIRAUM-VERLAG OKTOBER 2014
[… ]
Und in Theas zwölftem Jahr erklärte Karin ihr die geheimnisvolle Angelegenheit der Menstruation und wie man die Sache diskret behandelt und sauber verpackt. Thea war entsetzt, reihte sich aber auch wichtigtuerisch bei den Freundinnen ein, die im Sportunterricht gern mal auf der Bank Platz nahmen, sich den Bauch hielten und zusahen, wie die ungelenken Kameradinnen beim Bodenturnen versuchten, eine gute Figur zu machen.
Außer dass Thea jetzt an Mutters Nachtschrank durfte, weil dort die Hygieneartikel für die Frau verstaut, richtiger wohl, versteckt, waren, sprach die Mutter mit ihr über die Angelegenheit kein Wort.
Sie gehörte zu der Generation der verklemmten Mütter, die mit ihren Körpern nicht klarkamen, sie für etwas Unanständiges hielten, die ihre Eltern nie nackt gesehen haben, und ihren Kindern gern weisgemacht hätten, sie selbst seien schon bekleidet auf die Welt gekommen. Thea wundert es zuweilen, dass sie sich überhaupt vermehrt haben.
Ihre Schwester jedenfalls war noch vollkommen überrascht worden von Bauchschmerzen und verschmutzter Unterwäsche. Die hatte noch gedacht, sie sei plötzlich unheilbar krank und müsste sterben. Die war verzweifelt in die Wäscherei PGH Edelweiß, in der die Mutter arbeitete, gelaufen. Und die Mutter hatte sie beiseite genommen und geflüstert, das wäre nichts Schlimmes, sie hätte jetzt ihre Tage, und in Mutters Nachtschrank wären Binden. Und Karin, die bislang nur Binden kannte, die man sich ums aufgeschlagene Knie wickelte oder um die verstauchte Hand, stand hilflos im elterlichen Schlafzimmer. Allein, verheult, verängstigt, und vor allem verschämt.
Später haben sie wohl über diese Begebenheit gelacht, aber Thea findet, angesichts der Tatsache, dass so etwas noch Anfang der 1960er Jahre möglich war, es ist eine der traurigsten und unglaublichsten Episoden zwischen einer Mutter und einer Tochter in der Frauengeschichte der angeblich zivilisierten Welt.
Irgendwann zu der Zeit, als solcherart Frauenangelegenheiten sich in Theas Leben drängten, hörte sie auf, sich bei Kreisspielen auf der Straße von stolzen Königen lieb und warm halten, küssen und scheiden zu lassen. Sie ging mit Lothar Brandt aus der Parallelklasse und schrieb in der Bodenkammer ins Tagebuch: Ich liebe Herrn Sperlich. Deutsch. …
[…]
Aus familienorganisatorischen Gründen, damals hieß es, der Vater müsste „auf Schule“, weshalb die Mutter nun eine Arbeit annehmen wollte, hatte Thea zweieinhalb wichtige Jahre bei den Großeltern gelebt und war erst, als sie eingeschult wurde, wieder in die Familie zurückgekehrt.
„Auf Schule“ bedeutete in Wirklichkeit das Gefängnis, in dem der Vater einsaß, weil er versucht hatte, Geld zu unterschlagen. Knapp tausend Mark wohl. Thea hielt das nie für ein Kavaliersdelikt, aber das Urteil von zwanzig Monaten ohne Bewährung erscheint ihr, seit sie darüber Bescheid weiß, unverhältnismäßig. Der damals junge sozialistische Staat war vermutlich mehr beleidigt, als dass er geschädigt war. Er entließ den Familienvater in Unehren aus den Reihen der Volkspolizei, schickte ihn „auf Schule“ und hatte danach einen gebrochenen, ewig beschämten Bürger, der es sich selbst versagte, jemals wieder auf einen grünen Zweig zu kommen.
Natürlich war für Theas Mutter eine Welt zusammengebrochen. Sie war die Frau eines schneidigen Polizisten von Offiziersrang, die zu Hause sorgfältig die Wohnung und ihre drei Kinder gleichermaßen in Schuss hielt. Sie war angesehen in der Straße, in der die Familie lebte. Sie genoss es, wenn der Vater gelegentlich sogar ein Auto mit Chauffeur vor die Haustür schickte, die Mutter zum Friseur zu fahren.
Der Erdrutsch in die Position der Frau eines gemeinen Diebes, die nun mit drei Kindern für knapp zwei Jahre allein dastand, hätte gewaltiger nicht sein können.
Aber Theas Mutter muss diese Situation unvermittelt akzeptiert und tatkräftig in die Hand genommen haben.
Es ist die für Thea am weitesten zurückliegende Erinnerung, derer ihre Gedanken habhaft sind. Sie ist viereinhalb Jahre alt, zwei Polizisten sind zu Besuch, was nicht ungewöhnlich ist, und sprechen mit der Mutter allein im Wohnzimmer. Als die Mutter zu ihren Kindern kommt, sieht sie verweint aus, sagt, dass der Vater ganz lange „auf Schule“ müsse und es würde sich hier einiges ändern. „Auf Schule“ war für die Kinder bis dahin ein Begriff für die Abwesenheit des Vaters. Zu Thea sagt die Mutter, sie müsse arbeiten gehen, solange der Vater nicht da sei, Thea solle sich aussuchen, ob sie in den Kindergarten wolle oder zur Oma. In Theas Erinnerung hat die Mutter das alles noch am selben Abend angesagt.
Thea wollte zu Oma und Opa, jedenfalls landete sie dort. Ob sie das wirklich entschieden hatte, weiß sie nicht mehr. Oma und Opa wohnten in Altentreptow an der Tollense, fünf lange Zugstunden von Schwerin entfernt. Man fuhr dort nicht hin, um am Wochenende wieder nach Hause zu kommen. …
[…]
Aber ganz ablassen vom eigenen Leben konnte Thea auch nicht, denn zu offensichtlich war die Endlichkeit des Daseins in ihr Bewusstsein gerückt. Und der monotone Kreislauf der Generationsablösungen, der sich immer dann deutlich in den Vordergrund spielt, wenn die Vor- und Nachfahren der Familie in weißen Blusen und Hemden zu runden Geburtstagen antanzen und sich freundlich zu Schnappschüssen ewiger Erinnerungen vereinen, als sei das des Lebens Sinn, langweilt und ängstigt sie gleichermaßen.
Erst neulich, als Thea ihre Mutter zu einem Familientreffen fuhr, und hinten im Auto noch Conny und deren Tochter saßen, dachte sie plötzlich: Vier Generationen sitzen jetzt hier zusammen. Eine Matrjoschka hat die andere hervorgebracht. War das denn nötig?
Thea hat oft so seltsame Gedanken. Vielmals solche, die sich zu denken nicht gehören. Das ist ihr Schicksal seit langem. Und Thea glaubt, schlimmer ist nur dran, wer hellsehen muss.
Manchmal hatte sie sich gewünscht, sie hätte eine von diesen Furienmüttern werden können, die ständig die Arme ausbreiten, ihre Brut selbstgerecht an die große Brust zu holen und die nie den geringsten Zweifel an der Unschuld ihrer Kinder hegen, die lauthals und flügelschlagend alle und alles angreifen, was ihren Gören zu nahe tritt und die das unbedingt für Liebe halten. Aber auch dafür war Thea nicht geeignet. Nicht für die mit Blindheit geschlagene Übermutter und nicht für die konsequente, weitsichtige Erzieherin. Sie hätte klug daran getan, auf Mutterschaft zu verzichten. Auch das ist so ein Gedanke für den Giftschrank, obwohl er eigentlich nichts mehr anrichten kann, denn es sind da nun zwei Menschen unterwegs, die sich anschicken, beim großen Staffellauf bald an der Reihe zu sein, was nichts über die Qualität ihres Lebens aussagt, sondern nur benennt, dass etwas im Fluss geblieben ist, und dass einer weiß, wem er vorauslief und wem hinterher. Mehr nicht. Und nicht weniger. …