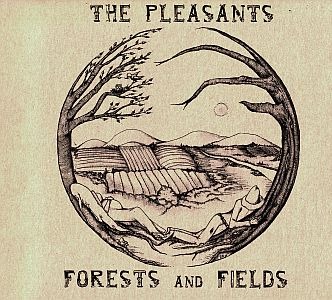Jo Müller, Das Winnetou-Puzzle, Karl-May-Verlag Bamberg 2010. ISBN 978-3-7802-0455-4Ich muss sechs Jahre alt gewesen sein. Gerade erst habe ich mit Grimms Märchen mein erstes wirkliches Buch gelesen. Noch nicht lang war ich in der Lage, aus Buchstaben Wörter und aus ihnen Sätze zu finden. Doch die Sucht nach Geschichten ließ mich nicht ruhen. Neugierig griff ich nach dem unscheinbaren grünen Buch – Der Schatz im Silbersee, eine zerlesene Kriegsausgabe ohne buntes Titelbild. Irgendwann hatte meine Mutter den Band geschenkt bekommen. Jetzt stürzte ich mich auf ihn. Denn es sollten Indianer darin vorkommen. Und das war für mich das Größte, was ich mir damit vorstellen konnte. Schnell war ich trotz der Schwierigkeiten, englische Begriffe wirklich aussprechen zu können von der Geschichte gefangen und folgte den Figuren durch den Wilden Westen Karl Mays hin zum geheimnisvollen Silbersee. Seither hab ich den Roman unzählige Male neu gelesen und bin seinem Zauber jedes Mal verfallen.
Jo Müller, Das Winnetou-Puzzle, Karl-May-Verlag Bamberg 2010. ISBN 978-3-7802-0455-4Ich muss sechs Jahre alt gewesen sein. Gerade erst habe ich mit Grimms Märchen mein erstes wirkliches Buch gelesen. Noch nicht lang war ich in der Lage, aus Buchstaben Wörter und aus ihnen Sätze zu finden. Doch die Sucht nach Geschichten ließ mich nicht ruhen. Neugierig griff ich nach dem unscheinbaren grünen Buch – Der Schatz im Silbersee, eine zerlesene Kriegsausgabe ohne buntes Titelbild. Irgendwann hatte meine Mutter den Band geschenkt bekommen. Jetzt stürzte ich mich auf ihn. Denn es sollten Indianer darin vorkommen. Und das war für mich das Größte, was ich mir damit vorstellen konnte. Schnell war ich trotz der Schwierigkeiten, englische Begriffe wirklich aussprechen zu können von der Geschichte gefangen und folgte den Figuren durch den Wilden Westen Karl Mays hin zum geheimnisvollen Silbersee. Seither hab ich den Roman unzählige Male neu gelesen und bin seinem Zauber jedes Mal verfallen.
Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass ich mittlerweile die Figur des Autors genauer studiert habe und auch die Geschichte der Indianer selbst mir nicht mehr fremd ist. Auch nicht, dass mir gerade die in anderen Büchern penetrante Form Mays zu spontanen Predigten auf die Nerven geht und seine Gedichte mich höchstens zum Lachen reizen. Wie auch die Versuche, der Karl-May-Jünger, ihn zum Weltliteraten aufzubauen und jegliches Objekt der Bücher biografisch zu begründen. Die Wahrheit und Schönheit der damals erträumt-erlesenen Abenteuer bleibt davon unangetastet.
Daran musste ich denken, als ich jetzt Jo Müllers Buch „Das Winnetou-Puzzle“ las. Denn was der Autor in seinem im Karl-May-Verlag erschienenen Debüt vorgelegt hat, ist eine Einladung zur Erinnerung, zum Suchen in Fantasie und Biografie, zum Stöbern in alten Schatzkarten und neuen Zeichen in scheinbar eindeutigen Bildern.
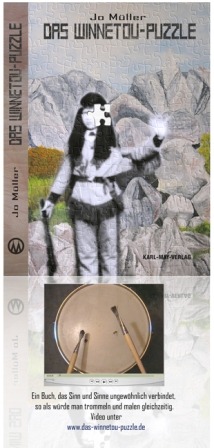 Wird dem Ich-Erzähler die Begegnung mit Winnetou als Buch und Puzzle zum Leitmotiv des Lebens, so regt Jo Müller, der das Buch als Ergänzung zu seinem Internetprojekt sieht, seine Leser an, neue Spuren im Vorfindlichen zu entdecken. Eine Kindheit mit Indianerspielen, mit gemeinsamen Schatzsuchen und Mutproben und ein Puzzle mit dem Bild Winnetous ist dafür lediglich der Ausganspunkt – ob real oder nicht. Freundschaft und Beziehungen – so wie Winnetou ohne Old Shatterhand nicht denkbar ist, so ist die Figur des Freundes, die in der Kindheit selbstverständlich ist später immer als Anklage und Ansporn im Hintergrund vorhanden.
Wird dem Ich-Erzähler die Begegnung mit Winnetou als Buch und Puzzle zum Leitmotiv des Lebens, so regt Jo Müller, der das Buch als Ergänzung zu seinem Internetprojekt sieht, seine Leser an, neue Spuren im Vorfindlichen zu entdecken. Eine Kindheit mit Indianerspielen, mit gemeinsamen Schatzsuchen und Mutproben und ein Puzzle mit dem Bild Winnetous ist dafür lediglich der Ausganspunkt – ob real oder nicht. Freundschaft und Beziehungen – so wie Winnetou ohne Old Shatterhand nicht denkbar ist, so ist die Figur des Freundes, die in der Kindheit selbstverständlich ist später immer als Anklage und Ansporn im Hintergrund vorhanden.
Die fehlenden Teile des Puzzles, das irgendwann mehr oder weniger zufällig wieder auftaucht, regen zum Nachdenken über Realität und Traum, über Bild und Wirklichkeit an. Die Figur des Winnetou ist ebenso nur eine Facette des Nachdenkens über Freundschaft und Kindheit wie Häuptling Crazy Horse, der dem Erwachsenen auf seiner Suche erscheint. Letztlich ist die Suche nach dem Schatz – was auch immer das ist, vergleichbar mit dem Erblicken eines verzerrten Bildes in einem trüben Spiegels. So in etwa, wie es der Apostel Paulus das Nachdenken über die Auferstehung beschreibt. Es gibt keine wirkliche Klarheit. Auch Platons Höhlengleichnis steht Pate in dem ständig mäandernden Erzähl- und Gedankensträngen. Wahre Erkenntnis ist im unvollkommenen Leben unmöglich. Nur Schatten sind die Bilder, die wir von der Wirklichkeit wahrnehmen. Nur Hilfskrücken die Sätze, mit denen wir unsere Wahrnehmungen beschreiben können. Und allzuoft deuten wir in die Spuren und Zeichen Dinge hinein, die wir gerne dort sehen möchten. Mit der Realität haben sie aber nur insofern zu tun, weil unser Denken sie dort erkennen möchte.
Stilistisch ist das Buch schwer zu fassen. Wahrscheinlich sollte man es als eine lange Meditation betrachten. Denn immer wieder verschwinden Erzählstränge, vermischen sich Traum und Bericht, offenbaren immer neue Facetten des Seins und Fühlens des Erzählers und versuchen ähnliche Assoziationen beim Leser hervor zu rufen. So wie in den Bildern des Erzählers immer neue – und so nie geplante und doch vorhandene Details gefunden werden, so werden bei jedem Leser wahrscheinlich unterschiedliche Erinnerungen freigelegt. Und diese machen zumindest für mich den entscheidenden Reiz der Lektüre aus. Denn manche der Abschnitte des Buches sind für mich zu fern jeglicher Relevanz – oder zu abgehoben und konstruiert.
Leider merkt man dem Buch nämlich an, wie dem Autor die Sprache immer wieder entgleitet. Formulierungen wirken seltsam konstruiert oder einfach über-ambitioniert. Hier hätte man dem Autoren einen Lektor gewünscht, der die großartige Substanz der Erinnerungen von all zu vielen Phrasen befreit hätte. Besonders aufgeregt hat mich in dieser Beziehung die seltsame Bemerkung des gemalten Bildes über seinen Schöpfer und seinen Inhalt.
Dies macht das „Winnetou-Puzzle“ für nicht von May infizierte Leser zu einem Ärgernis, mindert auch beim May-Kenner zumindest die Lesbarkeit des Buches entscheidend. Dies ist wirklich schade, ebenso wie die Tatsache, dass die Bilder, die zur Geschichte untrennbar dazu gehören, nur in einer recht zweifelhaften Druckqualität beigegeben wurden. Dies macht die eigene Suche nach den Details der Darstellungen so gut wie unmöglich. Da sollte der Leser parallel lieber die Darstellungen im Internet anschauen.