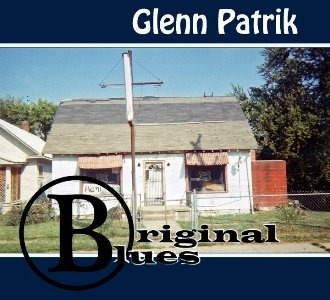Ihr Lieben,
Ihr Lieben,
was erwarte ich eigentlich, wenn ich mich zur Zeit hinsetze, und eine Predigt schreibe? Ich hoffe immer, dass ich nicht alleine dasitze. Ich hoffe, dass ein Gespräch zu Stande kommt über die Dinge, die mir dabei durch den Kopf gingen. Und ich hoffe, dass wir hier ein Stück davon erleben, was für mich „Gemeinde“ heißt.
Gemeinde – das ist mehr als eine Gruppe von nur Hörenden und Betenden. Und vor allem: es ist mehr als eine Gruppe von Freunden, die sich einfach so mal treffen auf nen Kaffee oder ein Bier. Gemeinde, das ist wahrscheinlich am ehesten zu umschreiben für mich als eine Kombination von beidem: Freunde, die gemeinsam leben und gemeinsam nach Gott fragen.
Wenn man das auf die gesamte christliche Gemeinde in aller Welt ausdehnen will, dann gerät man damit ganz schnell an Grenzen, wie es die Geschichte verdeutlicht, die ich bei einer dänischen Predigerin fand:
Ein amerikanischer Religionsforscher nahm sich einmal vor, alle Kirchen und Sekten des Landes zu beschreiben. Sowohl kleine wie große. Er suchte große Kathedralen auf, die über die am besten organisierte kirchliche Arbeit verfügten. Er kam auch in mittelgroße Versammlungen gläubiger Menschen, die er gründlich befragte. Und schließlich kam er zu einer kleinen christlichen Glaubensgemeinschaft, die nur aus zwei Menschen bestand. Es war das Ehepaar Tom und Emma. Der Religionsforscher stellte Tom die Frage: Bist du dir nun auch ganz sicher, dass ihr beide, du und Emma, das wahre Christentum habt? Tom runzelte die Stirn, sah nachdenklich ins Leere und antwortete dann zögernd: „Ich muss zugeben, ganz sicher bin ich mir bei Emma nicht!“
Wir können uns nicht einigen über unseren Glauben, das ist den Christen schon bald nach Jesu Himmelfahrt klar geworden. Klar – es gibt die eindeutigen Zeichen, an denen man erkennt: Der ist Christ: er ist getauft. Und die Gemeinde, sie feiert gemeinsam das Abendmahl als Zeichen der Vergebung und der Verbundenheit mit Gott und unter einander. Aber ansonsten: Der Streit geht schon bald los. Man spricht sich gegenseitig ab, den wahren Glauben zu haben. Man macht sich gegenseitig madig vor anderen. Und letztlich macht man sich öffentlich lächerlich mit seinem Gehabe.
Schon im Jahre 48 gab es daher das erste große Treffen in Jerusalem, weil man sich nicht einig werden konnte, was eigentlich die Gemeinde ist, wer dazu gehört, und was für Bedingungen es dafür geben sollte. Die Einigung war ganz knapp.
In späteren Zeiten tauchen solche Streitigkeiten immer wieder auf. Und die Einigungen blieben aus. Denn weil jeder überzeugt war, die richtige Meinung zu haben, nahm man lieber Trennungen in Kauf als nach Kompromissen zu suchen. Wenn wir heute anschauen, wie viele verschiedene Kirchen und Gruppen es gibt, die sich „christlich“ nennen, dann ist das eine Folge davon. Christen streiten sich – und verzerren damit die Botschaft, die Jesus uns eigentlich mitgegeben hat.
Und – Jesus hat das wahrscheinlich schon geahnt. Denn er hat darum gebetet, dass wir einig sein sollen. So steht im 17. Kapitel des Johannesevangeliums:
Joh 17, 20-26
17,20 Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden,
17,21 damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, daß du mich gesandt hast.
17,22 Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind,
17,23 ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, daß du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst.
17,24 Vater, ich will, daß, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast; denn du hast mich geliebt, ehe der Grund der Welt gelegt war.
17,25 Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht; ich aber kenne dich, und diese haben erkannt, daß du mich gesandt hast.
17,26 Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen.
Der Text ist Teil eines Gebetes Jesu, der im Evangelium quasi die Rolle einer großen Abschiedsrede einnimmt. Jesus bittet bei Gott für seine Jünger. Und – komischerweise – er bittet Gott nicht um den richtigen Glauben bei ihnen. Er bittet darum, dass sie einig sind. Er bittet nicht um die erkenntnis der wahren Lehre. Er bittet Gott darum, dass Spaltungen ausbleiben, dass die Liebe jeden Streit überwinden soll.
Wir sind Wesen, die gerne Recht behalten. Wir scheuen uns nicht vor Streit und Trennung. Und wir begründen das gerne mit der Wahrheit. Wir behaupten gerne, wir hätten sie gepachtet. Dass wir uns zu schnell irren, daran denken wir nicht. Und das meine ich jetzt nicht nur im Bezug auf den Glauben, das betrifft uns Menschen an sich.
Als Jünger Jesu – und das macht Jesu Gebet deutlich – haben wir hier eine Aufgabe. Wir sind die eigentliche Botschaft, die Jesus der Welt überlässt für die Zeit, wo er nicht mehr sichtbar unterwegs ist mit uns. Wir sind das eigentliche Evangelium. Es geht nicht vordergründig um heilige Texte und ewige Wahrheiten, die wir weiter zu sagen haben. Es geht darum, eine Botschaft zu sein. Eine Botschaft der Liebe, die alle Streitigkeiten überwindet. Und das ist der Knackpunkt. Hier scheitere ich andauernd. Hier scheitern Christen andauernd. Hier liegt alles im Argen. Hier muss sich etwas ändern.
Wenn über dem Sonntag als Thema steht „Die wartende Gemeinde“, dann ist das eine Zustandsbeschreibung. Jesus verabschiedete sich von den Jüngern und kündigte – ohne nähere Zeitangaben – seine Rückkehr an. Und hinterließ uns eine Aufgabe für die Zwischenzeit: „Macht zu Jüngern alle Völker“.
Und auch wenn es inzwischen in aller Welt christliche Gemeinden gibt, haben Jünger das zu allen Zeiten ziemlich falsch verstanden. Von Mission mit Feuer und Schwert, von Kreuzzügen oder Hexenverbrennungen brauch ich hier nicht zu reden. Das halten uns andere schon immer vor. Aber ich rede davon, dass Gemeinden heute eher als organisierte Frömmigkeitsinstitutionen mit Möglichkeit zur Steuerabschreibung sind und keine Gruppen, deren Liebe nach außen abstrahlt. Das Zusammenleben funktioniert oft nicht. Und damit kommt auch die eigentliche Botschaft nicht mehr bei den Menschen an sondern bestenfalls ein Zerrbild.
Ein Zerrbild, was bei manchen, die sich selbst als aufgeklärte Atheisten bezeichnen, dazu führt, jegliche Religionen als Störer einer friedlichen Entwcklung der Menschheit zu verdammen. Zum Glück für uns, sind sie nicht wirklich ein Beispiel für ein friedliches Miteinander, sonst hätten wir ein noch größeres Problem an den Hacken.
Woran liegt das? Bin ich selbst fähig, mit Menschen liebevoll zusammen zu leben? Bin ich nicht inzwischen ein völlig verbitterter und verknöcherter Einzelgänger geworden, den jede persönliche Frage schon erschreckt? Zu viele Tage gibt es, an dem diese Antwort zutreffend ist. Denn es fehlt das Vertrauen. Das Vertrauen auf Gott und das Vertrauen zu den Menschen. Das sind die Versuchungen, denen man im Glauben immer ausgesetzt ist. Zweifel und Streit als Ende von Liebe und Vertrauen.
„Have a little faith“ – Hab ein wenig Glauben. So heißt ein amerikanischer Fernsehfilm mit Laurence Fishburn nach einem Buch von Mitch Alborn. Und der hat mir das erst in den letzten Tagen wieder deutlich vor Augen geführt, wie wichtig es ist, dass man genau dann scheitert, wenn man sich immer nur auf sich selbst verlassen will. Die Geschichte, die Alborn schildert, ist eine, wie sie eigentlich überall auf der Welt vorkommen kann: Da wird ein Journalist von dem Rabbi seiner Kinderzeit gebeten, den Nachruf auf ihn zu schreiben. Und das bringt den ach so aufgeklärten Mann dazu, sich endlich wieder mit dem Glauben zu beschäftigen. Er befragt den alten Rabbi über das, was ihm im Leben und in der Gemeindearbeit wichtig ist. Und parallel dazu schildert er das Wirken eines ganz anderen Geistlichen, eines ehemaligen Drogendealers, der in den Armenvierteln der Großstadt eine Gemeindearbeit aufbaut. Egal ob es um wohlsituierte Juden oder um die Armen in der Großstadt geht: Nur wenn die Menschen darauf vertrauen lernen, dass Gott da ist, dass er uns helfen und unser Leben und unsere Welt verändern will, nur dann ändert sich wirklich etwas bei den Menschen.
Es ist – eine Woche vor Pfingsten als dem „Geburtstag der Kirche“ keine schlechte Idee, diesen Sonntag als Gebetstag für die Einheit der Kirchen zu begehen. Es ist aber genauso notwendig, diesen Tag – wie eigentlich jeden Tag – als Tag zu nutzen, um eine Stärkung unserer Fähigkeit zu einem liebevollen Miteinander von Gott zu erbitten. Darum, dass wir selbst in unserer so auf Selbstvermarktung und Selbstdarstellung gegründeten Gegenwart, Gottvertrauen und Glauben immer wieder neu lernen. Denn wenn ich selbst im Glauben wanke, wenn Gott für mich zu einem eigentlich unwichtigen Gegenüber wird, dann scheitere ich mit meinen Lebensplänen. Und dann bin ich nicht fähig, wirklich liebevoll mit den Menschen um mich herum umzugehen. Ein liebevolles Miteinander mit unseren Mitmenschen ist wichtiger als eine wohlformulierte und rhetorisch ausgefeilte Predigt. Denn – so hat es die spanische Mystikerin Teresa von Avila) einmal formuliert:
„Wir Christen sind die einzige Bibel,
die die Öffentlichkeit noch immer liest.
Wir sind Gottes letzte Botschaft,
niedergeschrieben in Werken und Worten.“
Wenn ich von Gott nichts mehr erwarte, wenn ich nicht darauf vertraue, dass er mich braucht und benutzen will, dann kommt seine Botschaft nicht mehr an. Wenn wir als Gemeinde nicht miteinander in Liebe und ohne Streitigkeiten auskommen, dann kapieren andere nicht, worauf es Gott ankommt, warum Jesus eigentlich in die Welt gekommen ist: als Zeichen für Gottes übergroße Liebe zu den Menschen.
Wir sollten hier gemeinsam etwas sehr Entscheidendes beachten: Es war keine Ermahnungsrede. Es war keine endlose Reihe von Befehlen von Seiten Jesu, indem er sagen würde: „Jetzt müsst ihr sehen, dass ihr einig werdet. Jetzt müsst ihr aufhören, Zeit und Kraft auf Diskussionen zu verwenden, was am richtigsten ist.“ Nein, es waren nicht solche Befehle, die Jesus formulierte. Es war ein Gebet, das er sprach.
Jesus hatte also erkannt, dass es nicht realistisch war, Einheit in der christlichen Kirche dadurch zu erreichen, dass er uns sagte, wir sollten uns untereinander einigen. Wäre es um unsere Einigkeit gegangen, wäre daraus sicher nie etwas geworden.
Und das bringt mich zum Kern dessen zurück, was eigentlich zu einer Gemeinde gehört: Das gemeinsame Gebet. Das Bitten um das, was uns nötig ist und der Dank dafür, dass Gott sich überhaupt mit uns abgibt. Der Dank dafür, dass es eben nicht auf unser ach so begrenztes Wirken sondern auf IHN ankommt.