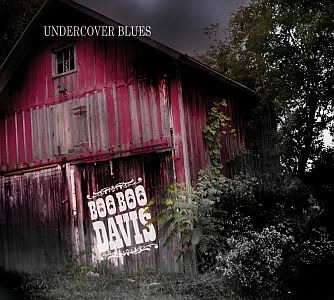Die Gitarre heult auf, die Rhythmen stampfen – man glaubt sich in den gleichen Schuppen versetzt, in dem Buddy Guy vor Jahren sein großartiges Album „Sweet Tea“ eingespielt hat: Rauher Juke Joint Blues erwartet einen, wenn „Diamonds And Stones“ losgeht.
„Strange Things“ ist eine umwerfend gute und packende Bluesnummer. Jake Lear ist ein Sänger und Gitarrist, der weder technische Mätzchen braucht noch seine Gitarre durch diverse Effekte aufpolieren muss. Direkt und ungefiltert kommt seine Strat daher. Und Roy Cunningham am Schlagzeug und Basser Carlos Arias unterstützen ihn auf „Diamonds and Stones“ bei einer Rundreise durch die Spielweisen einer Musik, die ein Kollege mangels Ideen als elektrifizierter Folkblues genannt hat. Was er damit eigentlich meinte (denn die Spielweisen des akustischen Folkblues werden hier eher seltener dekliniert) ist folgendes: Lear spielt den Blues mit einer Rauhheit und Intensität, die keine Rücksicht auf Begriffe wie „Radiofreundlichkeit“ nimmt. Er spielt und singt den Blues in der Nachfolge eher von Howlin Wolf oder Hound Dog Taylor als von B.B. King. Und damit ist er – um etwas aktuellers Namedropping zu praktizieren – näher an den White Stripes oder Bob Dylans letzten Alben als dran als an Joe Bonamassa oder Tommy Castro.
Im Laufe des Albums dekliniert er sich durch die verschiedensten Spielweisen des elektrischen Blues, ohne jemals nur in die Nähe aufgesetzter Rockermanie zu geraten: John Lee Hooker wird mit einer stoisch dahinrollenden Version von „Jack O‘Diamonds“ gewürdigt. Düsterer Swampblues verbirgt sich hinter dem Titelsong. Und aus Junior Wells‘ „Work Work Work“ wird gar ein knochentrockener Boogie mit texanisch angehauchten Surfgitarrenklängen. Und das abschließende „Boogie Time“ ist genau das: ein zum Tanzen zwingender Gitarrenboogie mit glasklaren Linien von Lears Strat: kalt, glänzend und gut.